

Eintauchen in das Weltgewebe |
|













































































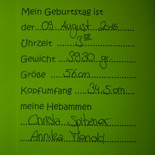








































 |
04.08.2022 um 11:12 Uhr |
 |
04.08.2022 um 11:11 Uhr |
 |
19.06.2022 um 12:25 Uhr |

|
Sprechzeiten Wir sind Montag bis Freitag von 09:00 bis 11:00 Uhr für euch da. vom 13.06.2022 bis zum 17.06.2022 ist unser Büro nicht besetzt. Bitte richten Sie Ihre Anfragen deshalb per Mail an E-Mail. Vielen Dank für Ihr Verständnis. |

|
Liebe HebammenstudentInnen und PraktikantInnen bis einschließlich März 2024 haben wir keine freien Externats- und/oder Praktikumsplätze mehr anzubieten. Anfragen ab April 2024 sind noch möglich. Vielen Dank für Euer Verständnis. Euer Geburtshaus-Team |

|
Kontaktaufnahme Für die erste Kontaktaufnahme bezüglich einer außerklinischen Geburt verwenden Sie bitte unser Kontaktformular. |

|
Liebe Eltern, wir sind bis einschließlich ET im Januar 2023 voll ausgebucht, Wartelistenplätze sind noch bedingt möglich, daher schicken Sie Ihre Anfragen bitte sehr frühzeitig. Dies gilt jedoch NUR für unsere Geburtshilfe, im Wochenbett-Team gibt es noch freie Kapazitäten. Vielen Dank und herzliche Grüße Das Geburtshaus-Team |

|
Akupunktur Die Akupunktursprechstunde findet wieder im Geburtshaus Tübingen statt. |
 |
Nächster Geburtsvorbereitungskurs Do: 01.01.1970 - |
 |
Nächster Rückbildungskurs Do: 01.01.1970 - |
 |
Nächster Säuglingspflegekurs |

|
um 13:33 Uhr
|
| zur Babygalerie | |

|
um 07:01 Uhr
|
| zu den Geburtsberichten |
|

|
ins Jahr 2018 |